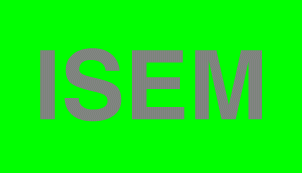gemeinsam mit dem
 Zentrum für Konfliktforschung
Zentrum für Konfliktforschung
Archiv zum Schlagwort
dritte Welt
Position 1: Veranstaltung 3 im Sommersemester 2005Position 2: Veranstaltung 12 im Wintersemester 2003-2004
Position 3: Veranstaltung 9 im Wintersemester 2001-2002
Position 4: Veranstaltung 12 im Wintersemester 1993-1994
|
23.05.2005
|
Seit der kubanischen Revolution war Lateinamerika für die wissenschaftliche und politische Orientierung einer kritischen Intelligenz von großer Bedeutung. Die sozialen Zustände des Subkontinents galten als exemplarisch für die Ausbeutung der Dritten Welt, und das wiederholte Eingreifen der USA gegen Befreiungsbewegungen und progressive Regime ließen sie als Hauptmacht einer weltweiten Konterrevolution in Erscheinung treten.
Parteiname für die kubanische Revolution, für die chilenische Unidad Popular und gegen Pinochet, für die Sandinisten und gegen die von den USA ins Leben gerufenen Contra galten als selbstverständlich. Und der wirtschaftliche Zusammenbruch Argentiniens war ein Lehrstück für das Schicksal eines Landes der Dritten Welt, das unter dem Diktat des Internationalen Währungsfonds die Rezepte neoliberaler Strukturpolitik befolgt.
Mit der Wahl des Metallarbeiterführers Lula zum Präsidenten des größten Landes des Subkontinents schien sich das Blatt zu wenden. Aber während den großen Erwartungen in Brasilien bald Ernüchterung und Enttäuschung folgten, verkündete der mit großer Mehrheit gewählte Präsident Hugo Chavez eine bolivarianische Revolution, die nicht nur in Venezuela die Massen der Ausgebeuteten und Unterdrückten zu Herren ihrer eigenen Geschichte machen soll. An Chavez scheiden sich die Geister: während viele Intellektuelle Venzuelas in ihrem Präsidenten nur einen Caudillo an der Spitze eines ineffizienten und teilweise korrupten Regimes sehen, setzen andere auf den Prozess der bolivarianischen Revolution als Weg zu einem Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Eine Auseinandersetzung mit dem heutigen Venezuela lenkt den Blick auf viele der ungelösten Probleme Lateinamerikas.
|
02.02.2004
|
Das Manuskript des Vortrages finden Sie hier:
leben.pdf
(37 kB)
Der räumliche Prozess sozialer Fragmentierung urbaner Räume ist keineswegs neu. Das traditionelle Spektrum der Separierung reicht dabei von ethnischer Ghettobildung bis zu den unterschiedlichen Standortpräferenzen von Lebensaltersgruppen und betrifft Metropolen westlicher Industriestaaten ebenso wie Megacities der Dritten Welt.
Parallel zu diesen Vertikalstrukturen entwickelt sich nun – vor dem Hintergrund der Globalisierung und der damit verbundenen zunehmenden sozialen Polarisierung – eine zusätzliche räumliche Differenzierung innerhalb der einzelnen Statusgruppen selbst. Als Motive gelten dabei ähnliche Interessen hinsichtlich des Freizeitgenusses (z.B. spezifische sportliche Aktivitäten), gemeinsame Auffassungen über den Lebensstil oder eine gemeinsame Weltanschauung. Das Resultat sind "gated communities", mit Zugangsbarrieren versehene Wohnviertel, die sich durch Selbstverwaltung bewusst von der städtischen Gemeinschaft ausschließen. Damit wird eine neue Qualität räumlicher Trennung erreicht, die sich als freiwilliges "Leben hinter Mauern" charakterisieren lässt und die noch stärker als bisherige Segregationsformen soziale Konflikte fördert.
Im Vortrag werden anhand von Beispielen aus Nordamerika, Südamerika und Europa die räumlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen dieser "geschlossenen Gemeinschaften" vorgestellt.
|
17.12.2001
|
Skripte etc.
Das Skript des Vortrags finden Sie hier:
soli.pdf
(106 kB)
Die Folien des Vortrages mit der inhaltlichen Gliederung und den wichtigsten Aussagen finden Sie hier:
solifol.pdf
(22 kB)
Seit dem 11. September 2001 wird viel über Solidarität zwischen Staaten gesprochen. In erster Linie bezieht sich jedoch Solidarität auf das Zusammenleben von Menschen, auf ihre wechselseitige Abhängigkeit von einander und von einer Umwelt, die ihr Überleben ermöglicht.
Der Vortrag geht zunächst der Frage nach, welche Erklärungen es für der Phänomen der Solidarität unter Menschen gibt, in welcher Form Solidarität auftritt und wodurch Menschen zu solidarischem Verhalten motiviert werden. Gegenstand der Betrachtung sind u. a. die mechanische Solidarität (Durkheim), die das Überleben der Masse der Bevölkerung in den Entwicklungsländern sichert, die organisierte Solidarität in freien Interessenverbänden und die verordnete Solidarität im modernen Sozialstaat. Ferner als Erscheinungsformen der Solidarität: der Solidarismus der katholischen Soziallehre, der Kommunitarismus und die genossenschaftliche Solidarität.
In dem zentralen Teil des Vortrags werden besonders wichtige Bereiche diskutiert, in denen es Defizite an Solidarität gibt und Wege erörtert, wie diese Defizite zu mildern oder zu beseitigen sind: Solidarität zwischen Generationen, Solidarität mit Kindern, Ausgegrenzten, Behinderten, Fremden, mit den Armen der Dritten Welt, Solidarität im Wirtschaftsbereich (Zinswirtschaft und shareholder value versus Bedarfswirtschaft, Kooperationsökonomie, économie sociale, economy of affection, fair trade) und Solidarität mit der Umwelt.
Abschließend geht es um die Frage, wie sich der Widerspruch zwischen dem in der Realität zu beobachtenden Streben nach Individualismus und Freiheit im Sinne von Bindungslosigkeit sowie nach Verfolgung von Eigeninteressen einerseits und der theoretischen Einsicht in die Unausweichlichkeit solidarischen Verhaltens an der Schwelle der globalen Revolution andererseits überbrücken lässt.
|
14.02.1994
|