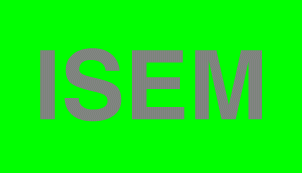gemeinsam mit dem
 Zentrum für Konfliktforschung
Zentrum für Konfliktforschung
Archiv zum Schlagwort
Israel
Position 1: Veranstaltung 3 im Wintersemester 2013-2014Position 2: Veranstaltung 6 im Sommersemester 2012
Position 3: Veranstaltung 10 im Wintersemester 2008-2009
Position 4: Veranstaltung 13 im Wintersemester 2007-2008
Position 5: Veranstaltung 1 im Wintersemester 2006-2007
Position 6: Veranstaltung 5 im Sommersemester 2002
|
04.11.2013
|
Ein Dossier zum Thema und Mitschnitte des Vortrags und der Diskussion sind hier bereitgestellt:
friedenisraelpalestina.pdf
Dossier zum Thema (340 kB)
friedenisraelpalestina-10.mp3
Vorstellung des Referenten durch Priv. Doz. Dr. Johannes M. Becker (4:43 min, 1,9 MB)
friedenisraelpalestina-21.mp3
Vortrag Teil 1 (20:42 min, 8,3 MB)
friedenisraelpalestina-22.mp3
Vortrag Teil 2 (26:25 min, 10,5 MB)
friedenisraelpalestina-30.mp3
Diskussion (37:37 min, 15 MB)
Clemens Ronnefeldt aus Freising bei München, seit 1992 Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes, hat in den letzten Jahren Iran, Syrien, Libanon, Ägypten, Israel und Palästina bereist, um dort Friedens- und Menschrechtsgruppen zu treffen, diese zu unterstützen und in Deutschland von deren Arbeit zu berichten. Zuletzt kehrte der Referent im Sommer 2013 aus Israel und Palästina zurück.
Im ersten Teil seines Vortrages wird Clemens Ronnefeldt geschichtliche Hintergründe anhand von Landkarten bis hin zu den aktuellen Friedensverhandlungen beleuchten, bevor er einzelne Friedensorganisation auf israelischer und palästinensischer Seite vorstellt, ebenso einige gemeinsame Projekte beider Konfliktparteien.
Seine Nahostreisen der letzten Jahre führten u.a. nach Tel Aviv, Haifa, Bethlehem, Ramallah, Hebron, Jericho, Jerusalem und in das Dorf Neve Shalom – Wahat al Salam (Oase des Friedens).
In Bethlehem konnte Clemens Ronnefeldt mit Mitarbeitern des Ökumenischen Begleitdienstes des Weltrates der Kirchen sprechen, in Hebron mit Vertretern des Christian Peace Maker Teams, die auf internationaler Ebene von außen kommend durch ihre Menschenrechtsbeobachtungen zu einer Deeskalation vor Ort beizutragen versuchen.
Einheimische Gesprächspartner waren u.a Dr. Mitri Raheb, der evangelische Pfarrer der Weihnachtskirche in Bethlehem sowie Faten Mukarker in Beit Jala, auf israelischer Seite das Stadtratsmitglied von Jerusalem, Dr. Meir Margalit und Eitan Bronstein von der Organisation "Zochrot/Erinnerung", die an der Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung in den Jahren 1947/48 in Israel erinnert.
Der Referent sprach auch mit Vertretern der Organisation "Trauernde Eltern/Parents Circle" sowie dem "Israelischen Komitee gegen Häuserzerstörungen".
Clemens Ronnefeldt wird Bilder vom Mauer- und Grenzzaunbau vor allem in Bethlehem zeigen, ebenso von Friedenskundgebungen gegen die Sperranlage in Bilin und Al Masara.
Der Referent wird auch Perspektiven für eine Konfliktlösung im Nahostkonflikt aufzeigen sowie eine Einschätzung der aktuellen Lage vornehmen.
|
02.07.2012
|
Den Mitschnitt des Vortrags und der Diskussion haben wir zur besseren Handhabung in mehrere Abschnitte
unterteilt. Alle Dateien sind hier bereitgestellt:
israel-palaestina-konflikt-10.mp3
Vorstellung des Referenten durch Priv. Doz. Dr. Johannes M. Becker (3:49 min, 1,5 MB)
israel-palaestina-konflikt-21.mp3
Vortrag Teil 1 (6:345 min, 2,6 MB)
israel-palaestina-konflikt-22.mp3
Vortrag Teil 2 (17:10 min, 6,9 MB)
israel-palaestina-konflikt-23.mp3
Vortrag Teil 3 (16:56 min, 6,9 MB)
israel-palaestina-konflikt-30.mp3
Diskussion (40:27 min, 16,2 MB)
Warum war es 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, dass der britische Außenminister die Einrichtung einer jüdischen nationalen Heimstätte versprach?
Der Vortrag analysiert die damalige Weltlage und zeichnet die darauffolgende Diskussion in der zionistischen Bewegung über die Frage eines jüdischen Staats nach, bis zum Abdriften dieser Diskussion infolge des Massenmords am europäischen Judentum.
Für eine heutige Lösung des Israel/Palästina-Konflikts ist es nötig, an beiden Punkten anzuknüpfen:
- an der von Chaim Weizmann vertretenen Mehrheitslinie im Zionismus und
- an den globalstrategischen Interessen der heutigen Weltmächte.
Prof. Dr. Rolf Verleger, Neuropsychologe an der Universität Lübeck, war Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland, schrieb "Israels Irrweg: Eine Jüdische Sicht" und war Vorsitzender der "Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost".
|
12.01.2009
|
dejuedlit.pdf
(80 kB)
"Seit Shoah und Holocaust, seit Auschwitz und Treblinka, seit Gaskammern und Krematorien ist nichts mehr 'normal', was mit Juden, von Juden, gegen Juden, durch Juden passiert".
Was die Wiener Dokumentarfilmerin Elisabeth Spira im Zuge des Libanonkrieges 2006 geschrieben hat, das gilt auch für die Literatur, zumal für diejenige, die von Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft nunmehr bereits in der dritten Generation seit dem Holocaust in deutscher Sprache in Deutschland und Österreich geschrieben wird.
Wie kaum eine andere ist diese Literatur grundsätzlich von Konstellationen des Konflikts geprägt, die sich nach den Erfahrungen der Shoa dramatisch und existentiell zugespitzt haben und über die Jahrzehnte hinweg vielfältigen literarischen Ausdruck finden. Prägende Themen sind dabei das immer wieder postulierte Beharren auf der Erinnerung an die Vergangenheit des Dritten Reichs und ihr Weiterwirken in der Gegenwart, das stete Ringen um die literarische Sprache, die zur "Sprache der Mörder" geworden ist, die Reflexion auf die eigene, stets prekäre literarische und politische Identität, die nicht selten ein vitales gesellschaftskritisches Potential impliziert, und das Verhältnis zum Judentum, zu Israel und zum Nahostkonflikt, der gerade in diesen Tagen wieder traurige Aktualität erhalten hat.
|
28.01.2008
|
Das nach dem letzten Libanonkrieg in der Frankfurter Rundschau veröffentlichte 'Manifest der 25' zu den aktuellen deutsch-israelischen Beziehungen hat eine lebhafte Debatte pro und contra ausgelöst. Die von Reiner Steinweg vorgelegte Dokumentation dieser Debatte umfasst 270 Seiten.
Während sich die deutsche Politik bedeckt hielt, hat ein ehemaliger Vizepräsident der israelischen Knesset Kritik an historischen Details geübt und die Autoren zu einer Konferenz über das Manifest nach Israel eingeladen, die im Februar von der Friedrich Ebert-Stiftung ausgerichtet werden wird. Es geht um Grundfragen der politischen Haltung: Kann, darf, muss das offizielle Deutschland angesichts seiner Geschichte und der daraus erwachsenen besonderen Beziehungen zu Israel zu den militärischen Reaktionen Israels auf die Proteste gegen seine völkerrechtlich illegale Siedlungspolitik und den Raketenbeschuss schweigen? Oder wären behutsame, aber deutliche Kritik und die Diskussion alternativer Vorgehensweisen nicht der bessere Freundschaftsdienst angesichts einer sich immer weiter zuspitzenden Situation, die für das kleine Land irgendwann unhaltbar sein wird?
Für Israel steht, wenn man diese Frage aufwirft, offensichtlich viel auf dem Spiel, sind Deutschland und die USA doch seine stärksten Stützen in der westlichen Welt. Für Deutschland stellt sich die Frage, ob es sich angesichts der Konflikte in der islamischen Welt und der Islamisten mit dem Westen eine als einseitig pro-israelisch wahrgenommene Politik auf Dauer wird leisten können.
|
23.10.2006
|
neuenaheostendiskl.pdf
(75 kB)
Thomas de Maizière kritisierte am 12. Oktober 2006 das angeblich zunehmende Bestreben rohstoffreicher Länder, ihre Öl- und Gasreserven als politische Waffe einzusetzen. Die Bemerkung ziele wohl auf Russland, unseren größten Gaslieferanten, meinte die Financial Times Deutschland.
Der Kanzleramtschef könnte den Gedanken vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des US-Senats, Richard Lugar, haben. Der hatte im September 2006 die Länder Venezuela, Iran und Russland als 'adversarial regimes' bezeichnet, also als uns antagonistisch gegenüberstehende Regime. Wir sind gewohnt, in den Kategorien konventioneller Kriege zwischen Nationen zu denken, doch Energie ist die Waffe der Wahl für die, die sie besitzen, so Lugar.
Lugar und die übrige US-Herrschaftselite denken nicht nur, sie handeln auch kriegerisch, in Afghanistan und im Irak; oder lassen kriegerisch handeln. Condoleezza Rice nannte die israelischen Zerstörungen im Libanon die Geburtswehen des Neuen Nahen Ostens. Offenbar wird da ein Monstrum geboren. Wozu wurde es gezeugt?
Der Vortrag soll geopolitische Hintergründe des Vorgehens der USA und ihrer Verbündeten im Nahen Osten liefern.
|
10.06.2002
|
Der Nahe Osten steht vor einer Explosion. Das ist nicht nur auf den 11. September 2001 zurückzuführen sondern mindestens ebenso auf den Beginn der al-Aksa-Intifada am 28. September 2000. Wollte man die gegenwärtige militärische Eskalation allerdings auf diesen Bereich konzentrieren, würde man dem vielfältigen Geflecht des Nahostkonflikts nicht gerecht werden. Wenn heute eine gerechte Lösung für Israelis und Palästinenser gesucht wird, müssen damit immer weiterführende Fragen verbunden sein, die den ganzen Nahen Osten betreffen: Wer darf von wo wie viel Wasser aus welchem Fluss für sein Volk nehmen? Wer folgt welchem Präsidenten, Regierungschef oder König? Und konkret auf Israel und Palästina bezogen: Kann es überhaupt einen palästinensischen Staat geben? Wem gehört Jerusalem? Lässt sich das geforderte uneingeschränkte Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge garantieren?
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden in einem ersten Teil die großen Entwicklungslinien des Nahostkonfliktes aufgezeigt: Wie ist der Sechstagekrieg von 1967 vor dem Hintergrund des damaligen Kalten Krieges zu interpretieren und wie hat sich das damals erschütterte Selbstverständnis der Palästinenser bis heute ausgewirkt? Warum ist der libanesische Bürgerkrieg zu einem der Schlüsselkonflikte für die gewaltsame Eskalation im Nahen Osten geworden? Wie konnte es zu den Friedensgesprächen von Madrid und Washington und zur Unterzeichnung des Gaza-Jericho-Abkommens kommen? Gerade hier wurde die Position der Vereinten Nationen und der Europäischen Union befragt, aber auch der entscheidende Einfluss König Husseins von Jordanien und die weltweite wenn auch nur kurzfristige – Allianz gegen Saddam Hussein.
Der zweite Teil zeigte ausführlicher die Umsetzung, Verschleppung und letztlich Aufkündigung des Gaza-Jericho-Abkommens auf und ging konkret der Frage nach, was heute alles gelingen muss, um Frieden in Nahost zu garantieren. In diesem Zusammenhang kommt auch der christlichen Minderheit eine entscheidende Rolle zu, weil immer mehr Kirchenführer politisch auf die Bühne treten. Das hat nicht zuletzt der Besuch von Papst Johannes Paul II. in Israel, den palästinensischen Autonomiegebieten, Jordanien, Ägypten und Syrien gezeigt. Wo stehen also die Christen in diesem Konflikt und warum lassen sich Religion und Politik in Nahost nicht trennen? Eine aktuelle Analyse der Belagerung der Betlehemer Geburtskirche versuchte, darüber Aufschluss zu geben.
Wenn alles im Nahen Osten unübersichtlich ist, bleibt eines klar: Die These Huntingtons vom "clash of civilizations" lässt sich auf diese Region nicht anwenden, sie wäre zu kurz gefasst. Denn im "Heiligen Land" prallen zwei Völker, zwei politische Systeme und drei Religionen aufeinander. Was hier geschieht, ist ein politischer Konflikt mit religiösen Inhalten, der sich nicht auf die Kulturtheorie beschränken lässt. Deshalb kann die Explosion nur vermieden werden, wenn eine Vielzahl politischer und religiöser Kräfte in diesem Prozess mitdenkt. Ob das gelingt, versuchte der Vortrag zu erläutern.