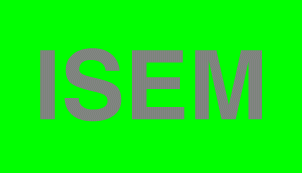gemeinsam mit dem
 Zentrum für Konfliktforschung
Zentrum für Konfliktforschung
Archiv zum Schlagwort
Kapitalismus
Position 1: Veranstaltung 2 im Wintersemester 2014-2015Position 2: Veranstaltung 1 im Wintersemester 2012-2013
Position 3: Veranstaltung 3 im Wintersemester 2010-2011
Position 4: Veranstaltung 5 im Wintersemester 2006-2007
Position 5: Veranstaltung 3 im Wintersemester 2005-2006
Position 6: Veranstaltung 2 im Wintersemester 2004-2005
|
27.10.2014
|
Die Folien des Vortrags und Mitschnitte des Vortrags und der Diskussion sind hier bereitgestellt:
kapitalismusundzukunftmanuskript.pdf
Folien (457 kB)
 Kapitel aus dem Buch Futuring (260 kB)
Kapitel aus dem Buch Futuring (260 kB)
kapitalismusundzukunft-10.mp3
Vorstellung des Referenten durch Priv. Doz. Dr. Johannes M. Becker (4:53 min, 2 MB)
kapitalismusundzukunft-21.mp3
Vortrag Teil 1 (28:36 min, 11,4 MB)
kapitalismusundzukunft-22.mp3
Vortrag Teil 2 (27:02 min, 10,8 MB)
kapitalismusundzukunft-30.mp3
Diskussion (20:47 min, 8,3 MB)
Jetzt wird geträumt, erhofft, gedacht, geplant, entschieden, gehandelt, investiert, kalkuliert, spekuliert, modelliert, vorgesorgt, verhütet, vorgebeugt, vorbereitet, verschuldet oder gedroht, gebombt, okkupiert oder ausgerottet – erstaunlicherweise immer (wieder) im Namen von etwas, was nicht geschehen ist oder womöglich niemals geschehen wird: der Zukunft oder der Zukünfte.
Und ständig versuchen wir, Zukünfte präsent (gegen-wärtig) zu machen, sie zu beeinflussen, sie zu machen. Wer den Kapitalismus kritisieren, reformieren oder radikal transformieren will, muss sich offenbar damit auseinandersetzen, dass dieser erstmals und immer noch eine Zukunftsgesellschaft ist. Ein enormer Konkurrent jeder Alternative. Der Vortrag handelt von Kapitalzeit, Vergegenwärtigung, Zukunftshandeln und dem, was man Futuring nennen könnte.
|
22.10.2012
|
Die Folien des Vortrags und Mitschnitte des Vortrags und der Diskussion sind hier bereitgestellt:
grossetransformation.pdf
Folien (113 kB)
grossetransformation-10.mp3
Vorstellung der Referentin durch Johannes Maser (6:05 min, 2,4 MB)
grossetransformation-21.mp3
Vortrag Teil 1 (14:05 min, 5,6 MB)
grossetransformation-22.mp3
Vortrag Teil 2 (31:38 min, 12,6 MB)
grossetransformation-30.mp3
Diskussion (26:27 min, 10,5 MB)
Signalisieren die aktuellen Krisen- und Konfliktdynamiken nur Regulationsdefizite an den Finanzmärkten oder nicht vielleicht doch den dramatischen Niedergang der kapitalistischen Wirtschaftsweise -"so wie wir sie kannten"?. Oder erleben wir aktuell die nicht minder dramatische Zersetzung der Demokratie? Welche Erkenntnisse ergeben sich aus einer feministischen Perspektive auf die gegenwärtigen Entwicklungen?
Die durch die Pleite von Lehman Brothers im September 2008 ausgelöste Finanz- und Wirtschaftskrise hatte der feministischen Patriarchatskritik zunächst zu unverhoffter, gleichzeitig aber auch höchst fragwürdiger Prominenz verholfen: "Die Männer sind schuld an der Krise" – titelte z. B. "die tageszeitung"; auch "The Economist" – ein durchaus wirtschaftsfreundliches Blatt – fragte, ob die Krise in dem Ausmaß und der Dramatik denn überhaupt stattgefunden hätte, wenn Frauen mehr Einfluss auf das Geschäftsgebaren an den Finanzmärkten hätten. Mittlerweile sind die Geschlechterkonstellationen der Krise längst wieder von der Agenda der hegemonialen Krisendebatten verschwunden. Es gibt eine wahre Flut an Krisenliteratur, in der die Geschlechterdimension der Krise aber kaum noch erwähnt wird. In feministischer Perspektive auf die aktuelle Vielfachkrise wurden die
platten Schuldzuweisungen an "die Männer" von vorneherein als essentialistisch zurückgewiesen und die Forderung nach einem "Geschlechtswechsel der Macht" wird der Komplexität der Verstrickung zwischen Macht- und Geschlechterverhältnissen sicher nicht gerecht.
Eine der zentralen Fragen im Kontext der Krise ist vielmehr auch in feministischer Perspektive die nach dem Verhältnis von Ökonomie und Politik, Kapitalismus und Demokratie.
|
08.11.2010
|
Das Skript des Vortrags finden Sie hier:
es.pdf
(224 kB)
Viele hegen Zweifel, ob man die Entwicklung der Welt dem Markt, Technokraten und Kapitalisten überlassen kann. Diese Zweifel teilt auch Thierry Jeantet, der Generaldirektor der Vereinigung der europäischen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit EURESA, dessen Buch "Economie Sociale – une alternative au Capitalisme" vom Referenten ins Deutsche übersetzt wurde und diesem Referat zu Grunde liegt.
Nach einer kurzen Einführung (warum kommt die Economie Sociale aus Frankreich, warum lehnen die Deutschen diesen Ansatz ab), werden zunächst die verschiedenen Erscheinungsformen des real existierenden Kapitalismus vorgestellt, vom fürsorglichen Familienkapitalismus bis zum zerstörerischen "Raubtierkapitalismus" und es werden Versuche beschrieben, das Image kapitalistischer Unternehmen durch freiwillige Übernahme von sozialer Verantwortung (corporate social responsibility) zu verbessern.
Den Hauptteil des Referats bildet eine Übersicht über die Besonderheiten der Economie Sociale als eine werteorientierte Form des Wirtschaftens ohne Fixierung auf Finanzfragen und die Erzielung von Rendite für das investierte Kapital, die prägenden Kernbegriffe und das wirtschaftliche Gewicht der weltweit verbreiteten Organisationen der Economie Sociale (Genossenschaften, Wirtschaftsvereine und Versicherungen auf Gegenseitigkeit). Auch die Probleme bei der Umsetzung dieses Konzepts eines "anderen Wirtschaftens" (entreprendre autrement) werden angesprochen, z.B. die mangelnde Sichtbarkeit dieser Bewegung, die sich aus vielen gleich gesinnten, aber getrennt operierenden Einheiten zusammensetzt und dabei ist, ihr eigenes betriebswirtschaftliches Instrumentarium zu entwickeln.
Den Heilmitteln der Vertreter des Kapitalismus für wirtschaftliche Schwierigkeiten (Privatisierung öffentlicher Unternehmen und Dienste und unbeschränktes Wachstum) werden die Entwicklungsstrategien der Economie Sociale gegenübergestellt: Nachhaltige Entwicklung, humane Globalisierung, gerechte Verteilung von Reichtum, z.B. durch Fair Trade. In einem Fazit werden die Argumente für eine weitere Verbreitung der Economie Sociale noch einmal zusammengefasst, mit neuen Ansätzen, natürliche, humane und wirtschaftliche Ressourcen zu mobilisieren, um die Weichen für eine gerechtere Wirtschaftsordnung zu stellen.
|
20.11.2006
|
"Innovation!" (Ein Selbstzeck?) "Wachstum!" (Wohin eigentlich?) "Neue Produkte" (welche auch immer?)
Die Frage nach dem tieferen Sinn des Produzierens ist erstickt. Die kapitalistische Wertschöpfung ist Selbstzweck, obwohl mit der wachsenden Produktion nicht mal mehr Arbeitsplätze mit wachsen. Ist das Sinnsuchen im Beruf antiquiert?
Der Philosoph Günther Anders prägte den Begriff "Der Antiquierte Mensch" (Buchtitel) für die wachsende Diskrepanz zwischen Technik und dem Mensch. Es handele sich einerseits um Überforderung durch unabsehbare Technikfolgen, andererseits um Unterforderung der menschlichen und moralischen Fähigkeiten durch Maschinenersatz und Sinn-Eleminierung. Die Fähigkeiten werden zur Brache.
Ähnliches geschieht durch die Globalisierung. Gibt es einen Weg zu einer aufgeklärt sinnorientierten Arbeitswelt, die über den Kapitalismus hinausweist, aber dennoch auf absolute, gar religiöse Wertsetzungen verzichtet?
Ja, viele Wege, wir müssen nur losgehen!
|
14.11.2005
|
Zunächst soll auf die Schwachstellen und Ungerechtigkeiten des deutschen Sozialsystems wie z.B. die zunehmenden Verzerrungen im Generationenvertrag, die Ungleichheiten zwischen ArbeitsplatzbesitzerInnen und Nicht-ArbeitsplatzbesitzerInnen sowie zwischen Personen mit einer erwerbszentrierten Biographie (in der Regel Männer) und jenen, die für die gesellschaftliche Reproduktion verantwortlich zeichnen (in der Regel Frauen), eingegangen werden.
Der Arbeitsgesellschaft geht zwar nicht die Arbeit aus, aber die arbeitsgesellschaftliche Grundlage des Wohlfahrtsstaats wird zunehmend porös. In der Globalisierungsdebatte werden nun aber nicht die inneren Widersprüchlichkeiten des Wohlfahrtsstaats aufgegriffen, um das zunehmend sich als unrealistisch erweisende erwerbsgesellschaftliche Grundskelett in Frage zu stellen, vielmehr ist an die Stelle der "Zähmung" des Kapitalismus durch den Wohlfahrtsstaat die neoliberale Zähmung des Wohlfahrtsstaats getreten.
Schwerpunkt des Vortrags wird die Erörterung des Um- bzw. Abbaus des Wohlfahrtsstaates mit seinen vergeschlechtlichen (gendered) bzw. antifeministischen "Reform" Vorschlägen sein. Wobei gezeigt werden kann, dass die Koordinaten neoliberaler Restrukturierung des Staats einen deutlichen Geschlechterbias haben.
|
01.11.2004
|
Warum ist unsere Welt überwiegend ungerecht, unfriedlich und so Konflikt beladen, instabil und nicht nachhaltig. Und haben wir eine Chance, die Welt, so wie wir sie gegenwärtig vorfinden, Schritt für Schritt zu verändern, sie menschlicher zu machen?
Armut, soziale Kälte, Massenarbeitslosigkeit, gewaltsame Konflikte sind keine Naturkonstanten, sondern von Menschenhand gemacht. Armut und Reichtum, der reiche Norden, der arme Süden, die da oben, die da unten haben weniger mit Mentalität, mit Religion und erst recht nicht mit ethnischer Beschaffenheit der Menschen zu tun, sie resultieren vielmehr aus einer Wechselwirkung zwischen ererbtem Eigentum und der angehäuften politischen und militärischen Macht. Soziale Spaltung und Konflikte werden dauerhaft, wenn es den Mächtigen gelingt, die Vielfalt von Kulturen und menschlichen Eigenschaften zu einem Gegeneinander zu missbrauchen, um ihre Privilegien zu verewigen.
Eine andere Welt ist dennoch möglich, wenn es gelingt, aus den negativen Erfahrungen mit Kapitalismus und Sozialismus zu lernen und einen Paradigmenwechsel zu Nachhaltigkeit und universaler Chancengleichheit herbeizuführen.