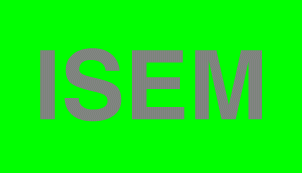gemeinsam mit dem
 Zentrum für Konfliktforschung
Zentrum für Konfliktforschung
Archiv zum Schlagwort
Mensch
Position 1: Veranstaltung 4 im Wintersemester 2004-2005Position 2: Veranstaltung 5 im Wintersemester 2004-2005
Position 3: Veranstaltung 10 im Wintersemester 2004-2005
Position 4: Veranstaltung 11 im Wintersemester 2004-2005
Position 5: Veranstaltung 6 im Wintersemester 2003-2004
Position 6: Veranstaltung 10 im Wintersemester 2003-2004
Position 7: Veranstaltung 11 im Wintersemester 2003-2004
Position 8: Veranstaltung 13 im Wintersemester 2003-2004
Position 9: Veranstaltung 6 im Sommersemester 2003
Position 10: Veranstaltung 8 im Wintersemester 2002-2003
Position 11: Veranstaltung 2 im Sommersemester 2001
Position 12: Veranstaltung 11 im Wintersemester 1999-2000
Position 13: Veranstaltung 13 im Wintersemester 1996-1997
Position 14: Veranstaltung 10 im Wintersemester 1995-1996
Position 15: Veranstaltung 11 im Wintersemester 1994-1995
Position 16: Veranstaltung 1 im Wintersemester 1993-1994
Position 17: Veranstaltung 4 im Wintersemester 1993-1994
Position 18: Veranstaltung 7 im Wintersemester 1988-1989
Position 19: Veranstaltung 11 im Wintersemester 1988-1989
Position 20: Veranstaltung 5 im Wintersemester 1987-1988
|
15.11.2004
|
Das Manuskript des Vortrages finden Sie hier:
seevoegel.pdf
(41 kB)
Das Verhältnis Mensch und Natur wird gegenwärtig durch das Schlagwort "Naturkrise unserer Zivilisation" gekennzeichnet. In der Natur- und Umweltpolitik gilt immer noch der von K. M. Meyer-Abich 1997 formulierte "Dreisatz":
- so geht es nicht weiter;
- wir wissen das; trotzdem aber,
- ändert sich (fast) nichts.
Dieses Dilemma hängt – mindestens auch – mit der Naturentfremdung zusammen, aus der das Referat Auswege aufzeigen will.
Zwei dieser Wege betreffen Bewusstseinsänderungen:
- die detaillierte Wahrnehmung einer nicht nur schwindenden, sondern leidenden Natur (z.B. verölte Seevögel als Patienten, deren Diagnose zu 99% hoffnungslos ist).
- die Überwindung der üblichen anthropozentrischen Nutzen-Ideologie hin zu der Vorstellung vom Eigenwert und Eigenrecht der Natur (vgl. das Franziskus-Motto: "Etwas Unkraut stehen lassen"). Der Biophilosoph Meyer-Abich hat in diesem Zusammenhang die Frage "Wozu ist die Natur für uns gut?" umgedreht in die Frage "Wofür sind wir gut in der Welt?".
Der dritte Weg aus der Naturentfremdung betrifft eine Auswahl aus der Vielfalt alter und neuer Vorschläge zur individuellen Naturerfahrung von der Kindheit an. Das entsprechende Kapitel des Vortrags trägt die Überschrift: "Wenn Du noch Sehnsucht hättest".
|
22.11.2004
|
Das Manuskript des Vortrages finden Sie hier:
Atomenergie und Radioaktivität
Link:
 Mensch und Technik I: Atomenergie und Radioaktivität -Syndrom einer nicht-nachhaltigen Entwicklung
Mensch und Technik I: Atomenergie und Radioaktivität -Syndrom einer nicht-nachhaltigen Entwicklung
Die Persistenz des Links wird nicht kontrolliert.
Die Atomenergie soll zur Verminderung der CO2-Emission eingesetzt werden, nach der Vision der US-amerikanischen Regierung sogar zur Erzeugung des Wasserstoffs, der die fossilen Energieträger möglichst vollständig ablösen soll. Welche Konsequenzen hat eine Renaissance der Atomenergie für unsere Region? Wird in dieser schönen neuen Welt wieder Kirchhain als Standort eines Atomreaktors aktuell?
Auch ohne einen Atommeiler in Kirchhain erreicht uns Radioaktivität aus der Anwendung der Atomenergie, wenn auch in kleinen Dosen. Gibt es aber für eine menschliche Zelle eine kleine Dosis oder kann nicht auch ein einzelner Strahlentreffer eine verhängnisvolle Mutation auslösen? Steht nicht die Radioaktivität mit ihren unausweichlichen Folgen in einem Konflikt zum ersten Grundbedürfnis des Menschen, der Gesundheit?
Die gesundheitlichen Schäden durch den Gebrauch des Urans werden in ihrer lokalen und globalen Verteilung quantifiziert. Kann eine Technik nachhaltig sein, die den überwiegenden Schaden bei denen auslöst, die nicht am Nutzen teilhaben können, sei es durch die globale Verteilung der radioaktiven Schadstoffe unter der jetzigen Generation, sei es durch die überwiegende Belastung der Folgegenerationen?
|
17.01.2005
|
Das Manuskript des Vortrages finden Sie hier:
ig.pdf
(141 kB)
Dieser Vortrag greift das Themenfeld "Mensch und Technik" wieder auf und beleuchtet im ersten Teil anhand von Beispielen die Frage, woher die Komplexität vieler Projekte und Anwendungen von Informationstechnik kommt und ob sie immer gerechtfertigt ist.
Im zweiten Teil werden zwei Zukunftsentwürfe – das laufende Aktionsprogramm der Bundesregierung und die Vision einer "nachhaltigen Informationsgesellschaft" einander gegenübergestellt.
Der Begriff "Informationsgesellschaft" ist ebenso vieldeutig wie der Informationsbegriff selbst. In einem technischen Sinne ist für eine solche Gesellschaft eine perfekte, flächendeckende technische Infrastruktur maßgeblich, die den reibungslosen Nachrichtenaustausch und die Computerisierung von möglichst vielen Arbeits- und Lebensvorgängen ermöglicht. Eine andere Interpretation stellt die Vision von stets wohlinformierten Menschen in den Mittelpunkt, die lästige Arbeit an Automaten delegieren und sich ihren schöngeistigen, unterhaltsamen oder sonstigen Interessen widmen können.
Das "Aktionsprogramm Informationsgesellschaft Deutschland 2006" der Bundesregierung zielt auf einen weiteren Ausbau der "Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK)" – vorrangig in den vier Handlungsfeldern Digitale Wirtschaft, Bildung und Forschung, Regierung und Verwaltung (eGovernment) sowie Gesundheitswesen (eHealth). Im Programm werden vorrangig Wege zur weiteren Automatisierung und Vernetzung in den genannten Bereichen betrachtet. Damit sind Effizienzgewinne und Einsparungen möglich und für die deutsche IT-Industrie lassen sich neue Impulse und Aufträge erwarten.
Auf der anderen Seite könnte es aber auch Tendenzen verstärken, die schon jetzt von vielen Menschen als einengend, frustrierend oder bedrohlich empfunden werden. Laufende Projekte wie die elektronische Mauterhebung ("Toll collect") oder die Gesundheitskarte binden wegen ihrer weitreichenden, hyperkomplexen Anforderungen nicht nur erhebliche Gemeinmittel, sondern wecken auch berechtigte Befürchtungen vor weiterer Erfassung, Ausspähung, Überwachung und verdeckter Diskriminierung durch staatliche und kommerzielle Datensammler.
Für viele Menschen kann eine "Informationsgesellschaft" nicht allein in der Computerisierung von elementaren Wirtschafts- und Lebensvorgängen wie einkaufen und verkaufen, lernen und unterrichten, miteinander kommunizieren, Arbeit oder Amtshilfe suchen, heilen und helfen bestehen. Eine Alternative könnte eine aufgeklärte, "nachhaltige Informationsgesellschaft" sein, die Technik daraufhin prüft, ob und wie sie nutzbringend zur Lösung drängender Menschheitsprobleme eingesetzt werden kann, wie z.B. zur Förderung nachhaltiger Entwicklungen im Sinne der Vision "Great Transition", die das Motto der diesjährigen Ringvorlesungsreihe bildet.
|
24.01.2005
|
Dieser Vortrag sucht Auswege aus der Misere einer Arbeitsgesellschaft, die auf den Warenmarkt bezogen ist und durch betriebswirtschaftliche Rationalisierung fortlaufend schrumpft. Immer mehr mit immer weniger Anwendung lebendiger Arbeit wird produziert. So entsteht die absurde, ja skandalöse Situation, dass sich bei wachsendem gesellschaftlichem Reichtum gleichzeitig die Armutsregionen verbreitern. Jedes 5. Kind in unserer Gesellschaft wächst unter Armutsbedingungen auf.
So stellt sich die Frage: Was geschieht mit den überflüssigen Menschen? Denn es ist beweisbar, dass Arbeit nach wie vor ein entscheidendes Medium der Persönlichkeitsbildung, der Festigung von Selbstbewusstsein, der sozialen Anerkennung und nicht zuletzt der Bedingung für ein Leben in Würde ist.
Der Vortrag sucht Krisenherde zu benennen, gleichzeitig jedoch Handlungsfelder aufzuzeigen, die Zukunftsperspektiven eröffnen.
|
01.12.2003
|
Mit der Entwicklung einer Naturerkenntnis begann der Mensch bewusst die Natur als ihn umgebende natürliche Ressource zu nutzen. Das zunehmende exploitive Verhalten führte in einen Konflikt zwischen Naturnutzung auf der einen und dem Naturschutz auf der anderen Seite. Der Vortrag stellt hierzu größere globale Gefährdungspotentiale dar.
Was kann in diesem Zusammenhang eine aktuelle Naturschutzbiologie in Lehre und Forschung vermitteln? Auf diese Frage wird im Vortrag näher eingegangen, Chancen und Probleme werden beleuchtet.