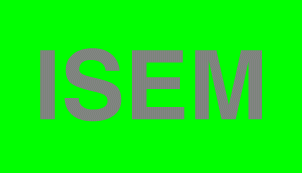gemeinsam mit dem
 Zentrum für Konfliktforschung
Zentrum für Konfliktforschung
Archiv zum Schlagwort
Naher Osten
Position 1: Veranstaltung 1 im Wintersemester 2006-2007Position 2: Veranstaltung 5 im Wintersemester 2003-2004
Position 3: Veranstaltung 5 im Sommersemester 2002
Position 4: Veranstaltung 2 im Wintersemester 2008-2009
|
23.10.2006
|
neuenaheostendiskl.pdf
(75 kB)
Thomas de Maizière kritisierte am 12. Oktober 2006 das angeblich zunehmende Bestreben rohstoffreicher Länder, ihre Öl- und Gasreserven als politische Waffe einzusetzen. Die Bemerkung ziele wohl auf Russland, unseren größten Gaslieferanten, meinte die Financial Times Deutschland.
Der Kanzleramtschef könnte den Gedanken vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des US-Senats, Richard Lugar, haben. Der hatte im September 2006 die Länder Venezuela, Iran und Russland als 'adversarial regimes' bezeichnet, also als uns antagonistisch gegenüberstehende Regime. Wir sind gewohnt, in den Kategorien konventioneller Kriege zwischen Nationen zu denken, doch Energie ist die Waffe der Wahl für die, die sie besitzen, so Lugar.
Lugar und die übrige US-Herrschaftselite denken nicht nur, sie handeln auch kriegerisch, in Afghanistan und im Irak; oder lassen kriegerisch handeln. Condoleezza Rice nannte die israelischen Zerstörungen im Libanon die Geburtswehen des Neuen Nahen Ostens. Offenbar wird da ein Monstrum geboren. Wozu wurde es gezeugt?
Der Vortrag soll geopolitische Hintergründe des Vorgehens der USA und ihrer Verbündeten im Nahen Osten liefern.
|
24.11.2003
|
"Im Umgang mit Syrien sind alle Optionen offen", sagt Jon Polten, Stellvertreter des Außenministers der USA. Eine mögliche Option wäre eine amerikanische militärische Intervention. Syrien sei eine doppelte Bedrohung: Damaskus unterstütze die Terrororganisationen und strebe nach Massenvernichtungswaffen.
Die amerikanische Liste der Forderungen an Syrien ist lang. Die USA verlangen von Damaskus volle und bedingungslose Zusammenarbeit. Faruk Aschrah, Syriens Außenminister, erklärt, sein Land sei bereit für eine intensivere Kooperation mit den USA, dennoch stellt er die Frage: "Welcher Staat in der Welt kooperiert vollständig mit den Vereinigten Staaten von Amerika?". Indirekt weist der Syrer auf Deutschland und Frankreich hin. Damaskus wartet nicht ab, sondern verstärkt seine Bemühungen um Amerika zufrieden zu stellen. Syrien schließt die Büros der palästinensischen Organisationen im Land; durch bessere Beziehungen zu Ankara will Syrien, dass die Türken sich in Washington für die Syrer einsetzen. Aber Ankara hat selbst Probleme mit der amerikanischen Politik im Nahen Osten. In Wirklichkeit arbeitet Syrien seit dem 11. September 2001 stillschweigend mit Amerika intensiver als je zuvor zusammen. Der Erfolg der USA bei der Verhaftung vieler Islamisten in Afghanistan und anderswo ist vor allem der Mithilfe aus Damaskus zu verdanken. Washington will aber nicht nur Konzessionen, sondern volle und bedingungslose Kooperation.
Werden die Machtaber in Syrien den amerikanischen Wünschen nachgeben oder ereilt ihnen das gleiche Schicksal wie ihren arabischen Brüdern in Bagdad? Über diese und andere Fragen möchten wir gemeinsam diskutieren.