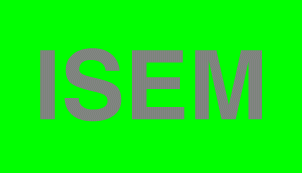gemeinsam mit dem
 Zentrum für Konfliktforschung
Zentrum für Konfliktforschung
Archiv zum Schlagwort
qualitatives Wachstum
Position 1: Veranstaltung 9 im Wintersemester 2007-2008Position 2: Veranstaltung 7 im Wintersemester 2004-2005
Position 3: Veranstaltung 3 im Wintersemester 2003-2004
|
17.12.2007
|
wachstum.pdf
(480 kB)
Bis heute ist mit wirtschaftlichem Wachstum meist ausschließlich die jährliche Zunahme an produzierten Güter und Dienstleistungen gemeint. Wie diese Zunahme zustande kommt, was und wie mehr produziert wird, wird meist vernachlässigt.
Seit den 1970er Jahren hat sich gegen diese rein quantitative Sichtweise zunehmend Kritik geregt. Anfangs wurde hauptsächlich aus einer ökologischen Perspektive darauf hingewiesen, dass viele negative Aspekte wie z.B. Umweltverschmutzung, Flächenversiegelung und der Verlust an Biodiversität gar nicht in die Berechnung des Wachstums eingehen. Es bedürfe daher einer Qualifizierung des Wachstumsbegriffs, so die Kritiker.
Heute ist es an der Zeit, den Wachstumsbegriff weiter zu qualifizieren:
- Welcher Typ von Wachstum schafft sichere, welcher prekäre Beschäftigung?
- Wie muss ein Wachstum aussehen, das vor allem den BezieherInnen niedriger Einkommen zugute kommt?
- Und wie kann das mit ökologisch nachhaltigem Wachstum sowie dem Abbau von Arbeitslosigkeit und Armut in Einklang gebracht werden?
|
06.12.2004
|
Das Manuskript des Vortrages finden Sie hier:
eumilit.pdf
(79 kB)
- Ausgangsbasis meiner Überlegungen ist der folgende Sachverhalt:
- Die herrschende Politik verlangt von den EU-Staaten höhere Rüstungsaufwendungen. Dies geschieht u.a. über
- die neue europäische Verfassung (Art. I-41, 1-3: Verpflichtung zur Aufrüstung, Aufbau einer europäischen Rüstungsagentur etc.).
- Dies geschieht, bzw. ist geschehen mit dem Aufbau einer Schnellen Eingreiftruppe der EU, mit dem Aufbau des Satellitensystems "Galileo", mit der Produktion des militärischen Transportflugzeuges Airbus 400 M.
- Meine Gegenthese, für die EU in 20 Jahren,
- Die EU sollte ein Leuchtturm in der Entwicklungspolitik werden, nicht in der weiteren Aufrüstung.
- Derzeit werden erdweit ca. 60 Mrd. $ aufgebracht für Entwicklungshilfe. (Verglichen mit knapp 1.000 Mrd. $ für Rüstung, ist dies beschämend.) Die EU steht hier mit einem ca. 50prozentigen Anteil nicht schlecht da. Aber es geschieht zu wenig. Dabei ist Entwicklungshilfe langfristig "profitabel".
- Die EU gibt derzeit ca. 50 Prozent ihres Haushaltes für den Agrarsektor aus, von diesen 50 Mrd. € wiederum ca. 25 Mrd. € für Subventions- und andere Abschottungsmaßnahmen. Die besten Beispiele liefert die Zucker- und die Baumwollproduktion. Würde die EU ein wachsendes Maß dieses Geldes neben umgeleiteten Rüstungsgeldern in neue "terms of trade", einen gerechteren Handel, leiten, würde sich das Gros der Rüstungsausgaben erübrigen.
- Die Grundlagen meiner Überlegungen sind
- Die sozialen Probleme der Erde (sh. Vortrag von M. Massarat, 1.11.04) sind derart groß, dass weitere Aufrüstung jeglicher Moral entgegenliefe (Kindersterben, Erwachsenensterben, Hunger, schlechte Wasserversorgung, unzureichende Bildungsmöglichkeiten u.v.m.
- Der Terrorismus, insbesondere der islamische Terrorismus, der derzeit zum Feindbild Nr. 1 aufgebaut wird, ist mit militärischen Mitteln nicht zu bekämpfen, geschweige denn: zu besiegen. Ja, die militärische Hochrüstung ist contraproduktiv! Nur mit sozialem Ausgleich kann etwas gegen ihn unternommen werden, kann sein soziales Umfeld gleichsam ausgetrocknet werden. Der Arbeitskreis Kriegs-Ursachenforschung (AKUF) der Universität Hamburg hat erforscht, dass ca. 90 Prozent aller Kriege aus der ungleichen Verteilung des Reichtums der Erde resultieren.
- Wenn wir von unseren gewaltigen Produktivkräften und unserer gewaltigen Produktivität etwas abgäben, unsere großen Mittel (s.o.) sinnvoll umleiteten, würden wir EuropäerInnen das Modell der Zukunft auf der Erde der 200 Nationen darstellen. Dabei müssen wir uns von herkömmlichen Wachstumsvorstellungen trennen: Das qualitative Wachstum ist unbedingt dem blinden quantitativen Wachstum vorzuziehen (Bau von Infrastruktur, umfassende Gesundheitsreform zugunsten eine breiten Versorgung, Wiederentdeckung des ÖPNV, lebenslanges Lernen u.v.m.). Dies sollte auch unsere Entwicklungshilfepolitik leiten.
- Für bereits Verzagte, Entmutigte – ein Gedicht von Bert Brecht
16 Prozent der Erdbevölkerung verfügen über ca. 75 Prozent des ökonomischen Reichtums. Diese 17 Prozent leben in den drei kapitalistischen Kräftezentren EU (455 Mio. Menschen), USA (270 Mio.) und Japan zuz. einiger "Tigerstaaten" (125 + 125 Mio.).
Die USA mit ihrem Bevölkerungsanteil von 4,5 Prozent wendet (mit 450 Mrd. US-$) etwa 50 Prozent der erdweiten Rüstungsausgaben auf. Die EU der 25 mit einem Anteil von 7,5 Prozent an der Erdbevölkerung "lediglich" ca. 20 Prozent.
Im Hintergrund stehen zwei Argumentationen: Die EU müsse den internationalen Bedrohungen, in erster Linie wird hier der Terrorismus genannt, entgegentreten. Zum anderen wird argumentiert, die große EU der 25 müsse dem Unilateralismus (lat: Einseitigkeit) der USA eine stärkere Militärmacht Europas entgegensetzen.
Unser Handeln sollte sich stärker volkswirtschaftlich organisieren als betriebswirtschaftlich.
Die EU der 25 bietet für einen Neuanfang gute Voraussetzungen. Ohne politische Kämpfe indes wird nichts zu bewegen sein.
"Wer noch lebt, sage nicht niemals!
Das Sichere ist nicht sicher
So, wie es ist, bleibt es nicht.
Wenn die Herrschenden gesprochen haben
Werden die Beherrschten sprechen.
Wer wagt zu sagen niemals?
An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns.
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns.
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich!
Wer verloren ist, kämpfe!
Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?
Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen
Und aus niemals wird: heute noch."
|
10.11.2003
|
Der Begriff "Qualitatives Wachstum" hat das gleiche traurige Schicksal erlitten wie die "Nachhaltigkeit": Beide sind, mit wenigen Ausnahmen, zu billigen Schlagworten verkommen, die hauptsächlich dazu dienen, einen unverminderten Wachstumsdrang fern von aller Nachhaltigkeit zu kaschieren.
Die Wertschöpfung der kapitalistische Marktwirtschaft lebt davon, dass sie kostenloses oder spottbilliges Naturvermögen in gewinnbringende Güter verwandelt und mittels lukrativer Dienstleistungen vermarktet. Sie ist durch gutes Zureden wie Appellen zum "Qualitativen Wachstum" nicht davon abzubringen, die Biosphäre in Konsumgüter und Abfall umzuwandeln, weil sie damit die Quelle und den Motor ihres Wachstums aufgeben müsste.
Eine Umgestaltung des Wirtschaftsprozesses hin zu einer Kreislaufwirtschaft, die einen komfortablen Lebensstandard bereitstellt, ohne die Lebensgrundlagen zu zerstören, kann nur dadurch erreicht werden, dass der Naturverbrauch schrittweise so weit begrenzt wird, dass die Regenerationsfähigkeit der natürlichen Systeme erhalten bleibt.
In seinem Buch Ausstieg aus dem Crash hat der Autor das Modell einer ressourcenbegrenzten Wirtschaft entwickelt, dass mit Marktwirtschaft und einer liberalen Gesellschaft voll vereinbar ist.