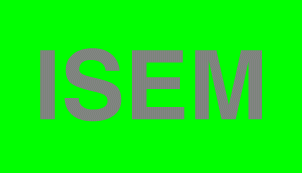gemeinsam mit dem
 Zentrum für Konfliktforschung
Zentrum für Konfliktforschung
Archiv zum Schlagwort
Hunger
Position 1: Veranstaltung 6 im Wintersemester 2014-2015Position 2: Veranstaltung 7 im Wintersemester 2014-2015
Position 3: Veranstaltung 7 im Wintersemester 2004-2005
Position 4: Veranstaltung 2 im Sommersemester 2004
Position 5: Veranstaltung 12 im Wintersemester 1988-1989
|
24.11.2014
|
Die Folien des Vortrags und Mitschnitte des Vortrags und der Diskussion sind hier bereitgestellt:
wachstum.pdf
Folien (3,1 MB)
wachstum-10.mp3
Vorstellung des Referenten durch Priv. Doz. Dr. Johannes M. Becker (4:37 min, 1,9 MB)
wachstum-21.mp3
Vortrag Teil 1 (31:26 min, 12,5 MB)
wachstum-22.mp3
Vortrag Teil 2 (33:03 min, 13,2 MB)
wachstum-30.mp3
Diskussion (17:25 min, 7 MB)
Begriffe wie "Klimakrise", "Energiesicherheit", "Resilienz" und "Postwachstumsgesellschaft", gar "Degrowth", die miltär-strategische Beschäftigung mit Ressourcenverknappung, Hunger und Migration zeigen, dass "Ökologie und Nachhaltigkeit" längst keine mit Umwelt- und Naturschutz abzuhandelnde Nebensache mehr sind, sondern eine materielle Basis für "Konflikte in Gegenwart und Zukunft", dem Grundthema der Vorlesungsreihe, bezeichnen.
Ist angesichts polymorpher, einander ansteckender Krisen von "Nachhaltigkeit", also einer "dauerhaft aufrecht erhaltbaren Entwicklung" überhaupt noch auszugehen?
|
01.12.2014
|
Die Folien des Vortrags und Mitschnitte des Vortrags und der Diskussion sind hier bereitgestellt:
hunger.pdf
Folien (1,8 MB)
hunger-10.mp3
Vorstellung des Referenten durch Saskia Roessner (2:55 min, 1,2 MB)
hunger-21.mp3
Vortrag Teil 1 (22:40 min, 9,1 MB)
hunger-22.mp3
Vortrag Teil 2 (23:39 min, 9,5 MB)
hunger-30.mp3
Diskussion (36:47 min, 14,7 MB)
Es gibt genügend Lebensmittel für alle Menschen auf der Welt. Trotzdem ist die globale Ernährung in Schieflage – 800 Millionen Menschen hungern, zwei Milliarden sind mangelernährt, circa 1,4 Milliarden übergewichtig. Und die Weltbevölkerung steigt an, auf bis zu neun Milliarden Menschen im Jahre 2050.
Welche Ursachen liegen dem defekten Ernährungssystem zu Grunde? Welche Chancen auf Veränderung gibt es? Wie werden wir uns in der Zukunft ernähren?
|
06.12.2004
|
Das Manuskript des Vortrages finden Sie hier:
eumilit.pdf
(79 kB)
- Ausgangsbasis meiner Überlegungen ist der folgende Sachverhalt:
- Die herrschende Politik verlangt von den EU-Staaten höhere Rüstungsaufwendungen. Dies geschieht u.a. über
- die neue europäische Verfassung (Art. I-41, 1-3: Verpflichtung zur Aufrüstung, Aufbau einer europäischen Rüstungsagentur etc.).
- Dies geschieht, bzw. ist geschehen mit dem Aufbau einer Schnellen Eingreiftruppe der EU, mit dem Aufbau des Satellitensystems "Galileo", mit der Produktion des militärischen Transportflugzeuges Airbus 400 M.
- Meine Gegenthese, für die EU in 20 Jahren,
- Die EU sollte ein Leuchtturm in der Entwicklungspolitik werden, nicht in der weiteren Aufrüstung.
- Derzeit werden erdweit ca. 60 Mrd. $ aufgebracht für Entwicklungshilfe. (Verglichen mit knapp 1.000 Mrd. $ für Rüstung, ist dies beschämend.) Die EU steht hier mit einem ca. 50prozentigen Anteil nicht schlecht da. Aber es geschieht zu wenig. Dabei ist Entwicklungshilfe langfristig "profitabel".
- Die EU gibt derzeit ca. 50 Prozent ihres Haushaltes für den Agrarsektor aus, von diesen 50 Mrd. € wiederum ca. 25 Mrd. € für Subventions- und andere Abschottungsmaßnahmen. Die besten Beispiele liefert die Zucker- und die Baumwollproduktion. Würde die EU ein wachsendes Maß dieses Geldes neben umgeleiteten Rüstungsgeldern in neue "terms of trade", einen gerechteren Handel, leiten, würde sich das Gros der Rüstungsausgaben erübrigen.
- Die Grundlagen meiner Überlegungen sind
- Die sozialen Probleme der Erde (sh. Vortrag von M. Massarat, 1.11.04) sind derart groß, dass weitere Aufrüstung jeglicher Moral entgegenliefe (Kindersterben, Erwachsenensterben, Hunger, schlechte Wasserversorgung, unzureichende Bildungsmöglichkeiten u.v.m.
- Der Terrorismus, insbesondere der islamische Terrorismus, der derzeit zum Feindbild Nr. 1 aufgebaut wird, ist mit militärischen Mitteln nicht zu bekämpfen, geschweige denn: zu besiegen. Ja, die militärische Hochrüstung ist contraproduktiv! Nur mit sozialem Ausgleich kann etwas gegen ihn unternommen werden, kann sein soziales Umfeld gleichsam ausgetrocknet werden. Der Arbeitskreis Kriegs-Ursachenforschung (AKUF) der Universität Hamburg hat erforscht, dass ca. 90 Prozent aller Kriege aus der ungleichen Verteilung des Reichtums der Erde resultieren.
- Wenn wir von unseren gewaltigen Produktivkräften und unserer gewaltigen Produktivität etwas abgäben, unsere großen Mittel (s.o.) sinnvoll umleiteten, würden wir EuropäerInnen das Modell der Zukunft auf der Erde der 200 Nationen darstellen. Dabei müssen wir uns von herkömmlichen Wachstumsvorstellungen trennen: Das qualitative Wachstum ist unbedingt dem blinden quantitativen Wachstum vorzuziehen (Bau von Infrastruktur, umfassende Gesundheitsreform zugunsten eine breiten Versorgung, Wiederentdeckung des ÖPNV, lebenslanges Lernen u.v.m.). Dies sollte auch unsere Entwicklungshilfepolitik leiten.
- Für bereits Verzagte, Entmutigte – ein Gedicht von Bert Brecht
16 Prozent der Erdbevölkerung verfügen über ca. 75 Prozent des ökonomischen Reichtums. Diese 17 Prozent leben in den drei kapitalistischen Kräftezentren EU (455 Mio. Menschen), USA (270 Mio.) und Japan zuz. einiger "Tigerstaaten" (125 + 125 Mio.).
Die USA mit ihrem Bevölkerungsanteil von 4,5 Prozent wendet (mit 450 Mrd. US-$) etwa 50 Prozent der erdweiten Rüstungsausgaben auf. Die EU der 25 mit einem Anteil von 7,5 Prozent an der Erdbevölkerung "lediglich" ca. 20 Prozent.
Im Hintergrund stehen zwei Argumentationen: Die EU müsse den internationalen Bedrohungen, in erster Linie wird hier der Terrorismus genannt, entgegentreten. Zum anderen wird argumentiert, die große EU der 25 müsse dem Unilateralismus (lat: Einseitigkeit) der USA eine stärkere Militärmacht Europas entgegensetzen.
Unser Handeln sollte sich stärker volkswirtschaftlich organisieren als betriebswirtschaftlich.
Die EU der 25 bietet für einen Neuanfang gute Voraussetzungen. Ohne politische Kämpfe indes wird nichts zu bewegen sein.
"Wer noch lebt, sage nicht niemals!
Das Sichere ist nicht sicher
So, wie es ist, bleibt es nicht.
Wenn die Herrschenden gesprochen haben
Werden die Beherrschten sprechen.
Wer wagt zu sagen niemals?
An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns.
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns.
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich!
Wer verloren ist, kämpfe!
Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?
Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen
Und aus niemals wird: heute noch."
|
10.05.2004
|
Schwerpunkt der diesjährigen Entwicklungspolitik sind die Millenniumsziele der Vereinten Nationen. Bis 2015 sollen die konkreten Meilensteine zur Verringerung der Armut und zur Verbesserung der Lebensbedingungen für die Ärmsten erreicht werden. Die Realität ist allerdings von den Millenniumszielen – insbesondere in Afrika südlich der Sahara – leider noch weit entfernt, zumal sich die Situation der Mehrheit dieser Länder während der letzten 10 Jahre verschlechtert hat.
Obwohl viele Staaten dieser Region sehr reich an natürlichen und wirtschaftlichen Ressourcen sind, leiden sie unter wirtschaftlicher Stagnation, unter gewaltsamen Konflikten und unter den katastrophalen Auswirkungen von Armut und Hunger.
In der Vielfalt der dort heimischen Kulturen, nämlich der islamisch und arabisch geprägten Gruppen einerseits und der verschiedenen afrikanischen Kulturen andererseits, entsteht ein großer Teil des Problems der sozialen Ungleichheit.
Im Vortrag werden zentrale Anregungen für eine Neuorientierung der Armutsbekämpfungs- und Entwicklungspolitik in Afrika gegeben, die auf die Aufwertung der Menschenrechte und Demokratisierung als wichtige Faktoren der nachhaltigen Entwicklung abzielt.
|
23.01.1989
|