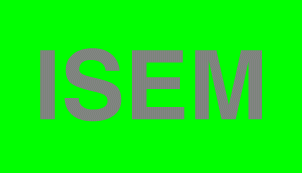gemeinsam mit dem
 Zentrum für Konfliktforschung
Zentrum für Konfliktforschung
Archiv zum Schlagwort
Umweltschutz
Position 1: Veranstaltung 2 im Sommersemester 2002Position 2: Veranstaltung 1 im Sommersemester 2001
Position 3: Veranstaltung 4 im Wintersemester 2000-2001
Position 4: Veranstaltung 2 im Wintersemester 1998-1999
Position 5: Veranstaltung 10 im Wintersemester 1992-1993
|
29.04.2002
|
Lange Zeit schien es, als sei mit dem Zusammenbruch des real-existierenden Sozialismus auch die Zeit politischer Alternativen zu Ende gegangen. Globalisierung ersetzte den Ost-West-Konflikt als dominierendes Paradigma der politischen Auseinandersetzung. Der Globalisierungsdiskurs begrenzt seitdem den Bereich des politisch Denkbaren und Möglichen. Der vorherrschende Tenor der politischen Debatte: Viel können wir uns nicht mehr leisten an Umweltschutz, sozialer Gerechtigkeit und Demokratie, um nicht zu riskieren, beim globalen Wettrennen geschlagen zu werden.
Um zu verstehen, wieso Globalisierung zu einem so mächtigen Konzept werden konnte, ist es hilfreich, zwei Dimensionen von Globalisierung zu unterscheiden:
Die erste Dimension betrifft die real stattfindende Denationalisierung ökonomischer und gesellschaftlicher Interaktionen: in zunehmenden Maße verlaufen Waren- und Finanzströme, Kommunikation und vieles mehr über Staatsgrenzen hinweg. Gleichzeitig ist die politische Regulierung dieser Prozesse noch weitgehend an Nationalstaaten gebunden. Die Liberalisierung der internationalen Finanzmärkte, sowie des Handels verursacht einen eingeschränkten politischen Handlungsspielraum der Nationalstaaten.
Die zweite Dimension der Globalisierung betrifft seine Macht als diskursive Ressource – eingesetzt von Regierungen und multinationalen Konzernen. Globalisierung wird als finales Argument genutzt, gesellschaftliche Reformen zu rechtfertigen oder als unausweichlich zu charakterisieren und andere als unrealistisch und utopisch abzutun. Die diskursive Macht dieser Argumente übertrifft bei weitem das reale Ausmaß der Globalisierungsfolgen für nationalstaatliche Politik.
Das dynamische Zusammenspiel dieser beiden Dimensionen in der Politik hat dem Globalisierungsparadigma seine disziplinierende Macht verliehen. Aber in den letzten 2-3 Jahren scheint die Hegemonie dieses Paradigmas ins Wanken zu geraten. Ausdruck dafür ist die Kommentierung des G8-Gipfel in Genua durch den Spiegel (30/2001): "Eine neue, erstmals wirklich internationale Protestgeneration heizt Politikern und Konzernchefs ein – und zwar zu Recht. Die globale Weltwirtschaft, mächtig und krisenanfällig zugleich, braucht neue Spielregeln." Dieser neuen globalen sozialen Bewegung ist es gelungen, eine Kritik der Globalisierung in die Öffentlichkeit zu tragen und dem Globalisierungsprozess vom Anschein der Alternativlosigkeit zu befreien. Die wichtigste Organisation innerhalb dieser breiten Bewegung ist Attac. Felix Kolb, Pressesprecher dieser Organisation, wird den Beitrag, die Rolle und die zukünftigen Aufgaben von Attac bei der Durchsetzung von politischen Alternativen analysieren.
|
18.04.2001
|
Skripte etc.
Das Skript des Vortrags finden Sie hier:
bedroh.pdf
(393 kB)
Der Eröffnungsvortrag der Ringvorlesung stellt vor, wie Psychologen Umweltkonflikte betrachten. An Umweltkonflikten herrscht kein Mangel. Hier ist an die Nutzung knapper Umweltgüter (z.B. Trinkwasser, saubere Luft), die Bewertung von Umweltrisiken (z.B. "Ist Sommersmog schädlich?") oder die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen ("Warum sollen wir teuren Öko-Strom kaufen?") zu denken.
Vertiefend wird auf den betrieblichen Umweltschutz eingegangen, der als Konfliktfeld eine besondere Herausforderung darstellt. So stoßen Umweltschutzmaßnahmen heute weniger auf technische Hemmnisse als vielmehr auf Akzeptanzprobleme bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei Führungskräften. Der Vortrag stellte exemplarisch diese Konflikte aus der Sicht betrieblicher Umweltakteure vor. Daraus wurden präventive Lösungsstrategien abgeleitet.
|
13.11.2000
|
Skripte etc.
Link zur Seite des Frauenbüros der Stadt Duisburg:
In der Agenda 21 spielt die Frauenpolitik eine zentrale Rolle:
- als Querschnittsaufgabe in der gesamten Agenda 21,
- mit dem Kapitel 24, "Globaler Aktionsplan für Frauen zur Erzielung einer nachhaltigen und gerechten Entwicklung" als eigenem Politikfeld verankert und
- im Zusammenhang den "Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21" (Kapitel 28) wird im Kontext der Erzielung Lokaler Agenden "die Beteiligung von Frauen und Jugendlichen an Entscheidungs-, Planungs- und Umsetzungsprozessen" besonders hervorgehoben.
Insgesamt liegt der Agenda 21 die Philosophie zugrunde, dass eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung ohne die Beteiligung von Frauen und ohne Frauenpolitik nicht möglich ist.
In Duisburg wurde im Ratsbeschluss zur Aufstellung einer "Lokalen Agenda 21 für Duisburg" die Frauenpolitik – bereits 1997 – als querschnittsorientiertes Handlungsfeld definiert. Das Frauenbüro der Stadt ergriff die Chance, seitdem schwerpunktmäßig zur lokalen Agenda 21 aus frauenpolitischer Perspektive zu arbeiten. Als großer politischer Erfolg ist zu werten, dass die Gleichberechtigung der Frauen bei der "Gestaltung der Zukunft" in der Präambel zu den Leitlinien einer lokalen Agenda 21 für Duisburg" im September 1998 per Ratsbeschluss verankert wurde. Auf Grund der innovativen Ansätze erhielt das Frauenbüro 1998 den Landespreis des Umweltministeriums NRW für das "beste LA-21"-Projekt im Kontext des Wettbewerbs "Öffentlichkeitsarbeit für eine nachhaltige Entwicklung in NRW" und ist auch in diesem Jahr mit einem neuen Projekt für diesen Preis nominiert.
Doris Freer wird über die neu entwickelten Arbeitsansätze und -methoden berichten. Schwerpunktthemen sind dabei die folgenden:
- Partizipation (frauenspezifischer Konsultationsprozess; Methoden und Formen der Beteiligung der Frauengruppen und interessierter Duisburgerinnen deutscher und nichtdeutscher Nationalität),
- Öffentlichkeitsarbeit für die Agenda 21 aus Frauensicht,
- Aufbau neuer agendarelevanter Vernetzungsstrukuren: Duisburger Frauennetzwerk Lokale Agenda 21; Arbeitskreis Duisburger Schulen und Agenda 21.
Des Weiteren werden Projekt und Aktionen zu folgenden Themen vorgestellt:
- Stadtentwicklung (Stadtplanung, Mobilität, Arbeitsplätze aus Frauensicht, Migrantinnen),
- Umweltschutz (Auswirkungen der Umweltverschlechterung auf Frauen),
- Bildungspolitik (Agenda 21 in der Schule unter der Perspektive von Frauenpolitik und Mädchenförderung),
- Erarbeitung von gleichstellungsorientierten Nachhaltigkeitsindikatoren mit dem Ziel der Perpetuierung des Agenda-Prozesses.
Die Referentin, Doris Freer, die in ihrer Funktion als Landessprecherin kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen NRW gleichzeitig als Landeskoordinatorin für die LA-21 aus Frauensicht fungiert, vertritt die These, dass die Agenda 21 eine historische Chance für die Herausbildung einer neuen Frauenbewegung bietet.
Genug Stoff also für eine interessante Diskussion!
|
02.11.1998
|
Skripte etc.
Skripte zum Vortrag finden Sie hier:
umwabspr.pdf
(44 kB)
|
18.01.1993
|